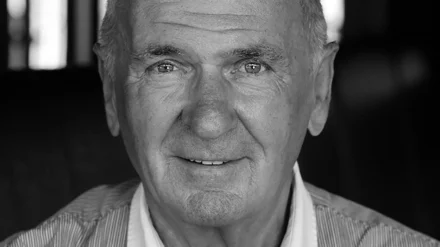Wo geht’s hier zur Krise?
Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein; wo jetzt noch Städte stehen, wird eine Wiese sein – so jedenfalls der Barockdichter Andreas Gryphius, dessen Pessimismus Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey, Meister des politischen Oxymorons, in ihrem neuen Buch Zerstörungslust. Elemente des demokratischen Faschismus wenigstens ein bisschen zu teilen scheinen. Schon in ihrem 2022er-Querdenker-Takedown Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus wurde jene Kunst des verblüffenden Ideologieparadoxons erfolgreich praktiziert: libertärer ... Autoritarismus?, rieb man sich die Augen, denn das schien begrifflich so gar nicht zusammenzupassen. Und jetzt "demokratischer Faschismus"? Kann es so etwas überhaupt geben?
Offenbar, und Zerstörungslust rekonstruiert gekonnt die majoritär abgesegnete Regression in den Rechtsautoritarismus mit Daten und Elan; Ende November bekommt das Autorenduo dafür in München den Geschwister-Scholl-Preis. Demokratischer Faschismus, das ist die "Verflechtung von faschistischen Neigungen und demokratischen Bekenntnissen", so definieren es der Soziologe Nachtwey und die Literaturwissenschaftlerin Amlinger, die beide an der Universität Basel arbeiten. Der titelgebende Begriff bleibt deshalb auch etwas konturlos, denn als die wahren Vertreter des – gegebenenfalls erst noch ethnisch zu bereinigenden – Volkes verstanden sich Faschisten schließlich immer schon.
Dass es jene Zerstörungslust gibt, ist freilich schwer zu bestreiten. Aber woher kommt sie? Manche Menschen, sagt schon Butler Alfred im Batman-Abenteuer The Dark Knight, wollen die Welt einfach brennen sehen. Amlinger und Nachtwey unterscheiden hier Erneuerer, Zerstörer und libertär-autoritäre Typen. Und auch deren destruktive Tendenzen lassen sich noch mal in drei Varianten unterscheiden: die ostentativ antiökologische, von der Politikwissenschaftlerin Cara Daggett so bezeichnete "Petromaskulinität", dann der "Akzelerationismus", der den angeblich unvermeidlichen sozialen Verfall gern noch beschleunigt sehen möchte, und der – immerhin – Destruktionismus à la Joseph Schumpeter; der österreichische Nationalökonom hatte einst den Begriff der "schöpferischen Zerstörung" geprägt.
Gemeinsam ist diesen Typen der Wunsch, sogar die Sehnsucht, soziale Institutionen radikal umzuformen und/oder abzuschaffen. Das lässt sich auch empirisch bestätigen, wie die von Amlinger und Nachtwey zitierte "need for chaos"-Theorie des dänischen Politikwissenschaftlers Michael Bang Petersen zeigt. Gleich mitserviert werden viele originelle Begriffsprägungen wie "soziale Klaustrophobie" oder "transversale Allianzen der Verlustabwehr", auch wenn nicht alles zündet: "Austeritätspolitik ist eine Form symbolischer Gewalt", das ist so was von 2017.
Wer sind also jene Zerstörer und Erneuerer? "Kränkungsanfällige, rachsüchtige Männer, die den Egalitätsschub in der Gesellschaft nicht verkraften"? Das wäre bequem, kann aber ja irgendwie nicht die ganze Wahrheit sein, denn die Zerstörungslust findet sich auch bei Frauen. "Statusangst" der Mittelklasse? Vielleicht, ist aber nicht neu. Eine verfallende Infrastruktur? "Die Bahn kommt chronisch zu spät", Brücken müssen gesprengt werden oder stürzen ein. Andererseits: Wi-Fi zu langsam? Bordbistro im ICE mal wieder geschlossen? Das ist nervig, klar, aber waren Internet und ICE in meiner Kindheit besser? Ach ja, richtig, es gab sie gar nicht!
Oder ist der Neoliberalismus schuld? Dessen zentrales Anliegen bestehe darin, "den Markt rechtlich und institutionell zu ummanteln, um ihn gegen demokratische Ansprüche zu schützen". Dies soll vermutlich etwas Schlechtes sein, aber es ist nicht ganz klar, inwiefern: Denn die Kernthese von Amlinger und Nachtwey ist ja gerade, dass demokratische Kräfte oft höchst problematisch sind. Ich persönlich möchte den Markt eigentlich ganz gerne – wenigstens manchmal – von demokratischen Ansprüchen isolieren, denn "demokratisch", das klingt zwar immer gut, aber Brexit und Trump sind ja demokratischen Ursprungs und nicht von amazon.com installiert.
Was sonst könnten die Quellen jener um sich greifenden sozialen Frustration sein? Bürokratie führt zu Bevormundung: Das ist eine weitere Konsequenz des Neoliberalismus, denn die Entfesselung von Marktdynamiken steigert in Wahrheit den Regulierungsbedarf, wie Amlinger und Nachtwey angenehm kontraintuitiv argumentieren. Gleichzeitig wird diese Bürokratie von Personen bevölkert, die anderen Menschen gerne ins Leben reinreden und moralistische Überlegenheit verspüren. Und: Meritokratie und Wettbewerb führen zu einem Gefühl des Bedrängtseins und der Prekarität. Weiter: Das von den Autoren korrekt als irreführend beschriebene "Nullsummendenken" lässt uns die gesamte Gesellschaft als Wettbewerb sehen, in dem es immer Gewinner und Verlierer gibt, aber keine Verbesserung für alle.
Und so weiter: Es werden viele verschiedene Erklärungsansätze für die destruktiven Energien der Gegenwart diskutiert, und man kann hier viel von Amlinger und Nachtwey lernen. Ein systematisches Gesamtbild mag sich trotzdem nicht ergeben. Wahrscheinlich gibt es auch einfach keins.