Polen und seine Erinnerungskultur: Scham und Schuld widersetzen sich jeder Eindeutigkeit
„Unsere Jungs“ heißt die Ausstellung im Rechtstädtischen Rathaus zu Danzig, die in Polen für mächtig Furore gesorgt hat. Denn was die Ausstellung zeigt, sind Geschichte und Schicksal der 450.000 polnischen Männer, die während des Zweiten Weltkriegs in der deutschen Wehrmacht Dienst taten. Tun mussten, um sich als „Volksdeutsche“ zu beweisen, widrigenfalls sie nach der deutschen Besetzung Polens als unerwünscht vertrieben oder gar ins KZ eingeliefert worden wären.
Verschattete deutsch-polnische Geschichte
Die polnische Politik, seit Jahren nationalistisch gestimmt und dies bis weit ins liberale Spektrum hinein, lief sogleich gegen die Ausstellung Sturm. Das seit jeher feststehende Selbstbild als entweder „Helden“ oder „Opfer“ wurde erschüttert.
In den zurückliegenden Jahren hat es mehrerlei Erschütterungen gegeben. Stets haben sie mit der für immer tief verschatteten deutsch-polnischen Geschichte zu tun, mit der Besatzung und mit dem Kernverbrechen der Shoah, das ein europaweites war, in Polen aber mit über drei Millionen ermordeten Juden seine fürchterliche Zuspitzung erfuhr.
Da sind die in deutsche Uniformen gesteckten Polen eher ein kleineres Problem; groß genug nur für wütende Stellungnahmen. Man möchte es so haben wie auf manchen der in der höchst sachlichen Ausstellung gezeigten Fotografien aus lange verheimlichtem Privatbesitz, wo die Uniform der abgebildeten Person nachträglich mit neutralem Schwarz unkenntlich gemacht wurde. Scham und Schuld deckten die Geschichte, obwohl sie doch unzweifelhaft eine von Zwang und Terror war.
Viel Scham und Schuld
Scham und Schuld kommen einem stromlinienförmigen Geschichtsbild immer wieder ins Gehege. Seien es die Pogrome, die einzelne Dorfgemeinschaften im Anschluss an den deutsche Einmarsch verübten, seien es die insgesamt dann doch sehr zahlreichen Denunziationen während der Terrorherrschaft der SS, oder seien es die antisemitischen Ausfälle, zu denen ein zunehmend wackeliges kommunistisches Regime 1968 griff, um – wieder einmal – den jüdischen Sündenbock zu präsentieren.
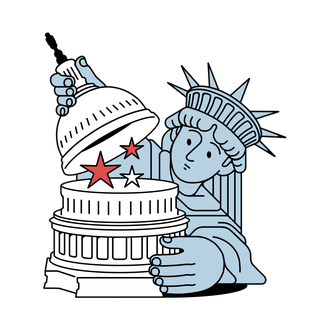
Donald Trump will die USA umkrempeln. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Kostenlos jeden Donnerstag per E-Mail – vom US-Team der Tagesspiegel-Redaktion.
Die damaligen Aktionen der polnischen KP, die zur Auswanderung von 90 Prozent der wenigen tausend in Polen verbliebenen Juden führten, hieß es vor nicht langer Zeit aus der rechten Ecke der heutigen Politik, seien von einer „fremden Macht“ ausgeführt worden, „die Vertreterin einer fremden Großmacht war“.
Die „fremde Großmacht“ liegt im Osten Polens, und sie heißt Russland, ob Zarenreich, Sowjetunion oder heutzutage unter Putin. Sie bedeutet neben der deutschen die andere, fortwährende Bedrohung der polnischen Staatlichkeit. Der 17. September als Jahrestag des Einmarsches der Sowjetunion infolge des Hitler-Stalin-Paktes im Jahr 1939 ist stets präsent, und ebenso, dass die Rote Armee kaum mehr als vier Jahre darauf als Befreier die Grenze überquerte, diese aber wie mit dem NS-Regime vereinbart beibehielt.
250.000 Polen landeten im Gulag
Nur durfte darüber vierzig Jahre lang nicht gesprochen werden. Noch traumatischer ist das Massaker von Katyn. Dort und an weiteren Orten ermordete der sowjetische Geheimdienst 22.000 polnische Offiziere, aber auch Intellektuelle und Priester, quasi als Auftakt zur Deportation von 250.000 Polen aller Schichten in den Gulag. Das Katyn-Museum in der Zitadelle von Warschau – die nach 1830 als russische Zwingburg über das aufständische Polen errichtet wurde – wartet mit der ganzen fürchterlichen Geschichte auf, illustriert mit tausenden Fundstücken aus den Massengräbern der polnischen Opfer in Russland und der heutigen Ukraine.
Dass auf dem Verschweigen der Vergangenheit keine gedeihliche Partnerschaft, schon gar nicht die regimeoffiziell beschworene Brüderschaft mit dem Sowjetvolk gedeihen konnte, liegt auf der Hand. Die heutige Leugnung eigener Verstrickung durch die rechte PiS-Politik jedoch trägt ebenso wenig.
Am ehesten kommt der Geschichte jedenfalls des späten kommunistischen Regimes die umfangreiche Ausstellung im „Europäischen Zentrum der Solidarność“ zu Danzig nahe. Aber das ist wiederum eine Erzählung nach dem Helden-Opfer-Muster. Hier die sich selbst ermächtigenden und alsbald das ganze Land mitreißenden Helden der Gewerkschaft mit dem einprägsamen Namen „Solidarität“, zugleich lange Zeit Opfer der detailgenau erzählten kommunistischen Repression, da die Finsterlinge von Miliz und Geheimdienst. Die freilich bleiben in der Darstellung ganz auf ihre Funktion reduziert, als ob sie nicht gleichfalls Mitbürger gewesen wären.
Bislang, so formuliert der Potsdamer Zeithistoriker Martin Sabrow, habe das Mantra gegolten, „Versöhnung durch Wahrheit“. Doch im heutigen Polen gehe es um „Geschichte als Schwert im politischen Kampf“, spitzt Jan Daniluk zu, der wissenschaftliche Leiter des anspruchsvollen Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Das ernüchternde Fazit steht am Ende der Reise, die eine Studiengruppe der in Berlin ansässigen Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur alljährlich in ein postsozialistisches Land führt und die diesmal Institutionen in Polen galt.
Es sind ihrer fast schon zu viele; allein in der Landeshauptstadt Warschau werben Museen zum Holocaust, zum Warschauer Aufstand oder zu Katyn um Aufmerksamkeit, und dabei ist das neue Museum der polnischen Geschichte in seinem bereits fertiggestellten Riesengebäude noch nicht einmal eröffnet, eben wegen der skizzierten Querelen. Danzig hält mit dem Solidarność-Zentrum und dem Museum des Zweiten Weltkriegs dagegen, beide am historisch zutreffenden Ort und spürbarem Lokalstolz.
Der Revolutionär und Marschall Józef Piłsudski.
Und dann gibt es noch einen Helden, auf den sich die streitenden Parteien ohne weiteres einigen – den Marschall Józef Piłsudski. Im Westen ist er allenfalls als Autokrat bekannt, der Polen seit seinem Staatsstreich 1926 allein regierte; nicht aber in seinen vielen Facetten als früherer Revolutionär, als Sozialdemokrat, als brillanter Heerführer im Kampf gegen die nach Westen drängende Rote Armee.
Das bekannte „Wunder an der Weichsel“ vom August 1920 wird in dem seinem Namensgeber gewidmeten Piłsudski-Museum vor den Toren Warschaus als Errettung Europas vor dem Bolschewismus gefeiert, um die Bedeutung des Nationalhelden gebührend herauszustellen.
Dass Piłsudskis Landsmann Feliks Dzierżyński zur selben Zeit den sowjetischen Geheimdienst aufbaute – man muss es sich hinzudenken. Im heutigen Polen ist Geschichte so lebendig und gegenwärtig wie vielleicht nirgends sonst, aber auch so voller scharfer Kanten.
Und wie nirgends sonst lässt sich lernen, dass historische Wahrheit ein Konstrukt ist, um so mehr, je weniger schon über die bloßen Fakten Einigkeit zu erzielen ist. Polen liegt zwischen dem westlich gewordenen Deutschland und dem östlich gebliebenen Russland. Es wäre viel gewonnen, wenn man sich deutscherseits darüber klar würde, was dieser Umstand bedeutet, zumal heute am Rande eines europäischen Krieges.

