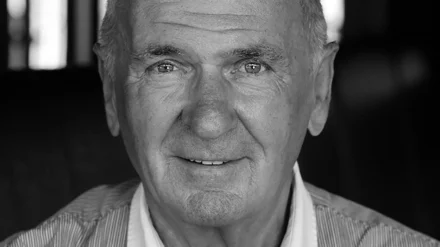Oberstufentriebwerk der Ariane 6 wird künftig in Deutschland montiert
Im baden-württembergischen Lampoldshausen wird in Zukunft das Oberstufentriebwerk für die europäische "Ariane 6"-Rakete endmontiert. Das teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit. In dem DLR-Werk in der Nähe von Heilbronn werden den Angaben zufolge aus Einzelteilen, wie zum Beispiel Turbopumpen, Ventilen und Schubkammern, fertige Triebwerke zusammengebaut. Das Triebwerk wird in dem Werk auch getestet.
Bisher erfolgte die Endmontage im nordfranzösischen Vernon. Zusammen mit der Systemintegration und den Flugabnahmetests wird die Endproduktion nun nach Deutschland verlagert. Laut DLR-Vorstandsvorsitzender Anke Kaysser-Pyzalla, ist der Standort Lampoldshausen nahe Heilbronn das europäische Testzentrum für Raumfahrtantriebe – und damit von zentraler Bedeutung für Europas unabhängigen Zugang zum Weltall.
Fertigstellung von deutsch-französischer Rakete verzögerte sich oft
Das fertige Triebwerk wird nach der Montage nach Bremen transportiert, wo es in die Oberstufe der Rakete eingebaut wird. Bei der Oberstufe handelt es sich um jenen Teil einer Rakete, der nach dem Start von den unteren Stufen getrennt wird, und alleine mit seinem eigenen Antrieb in die gewünschte Erdumlaufbahn steuert.
Die Ariane-Group wurde von Airbus und vom französischen Triebwerkshersteller Safran gegründet. Die DLR koordiniert das von Deutschland bereitgestellte Budget in Höhe von 800 Millionen Euro.
Das sogenannte "Vinci"-Triebwerk, das bald aus Baden-Württemberg seinen Weg in die Ariane finden wird, war eigentlich für eine verbesserte Version des Vorgängermodells Ariane 5 geplant. Dort kam es aber nicht zum Einsatz, da die Ariane 5 Version ME nicht weiterentwickelt wurde.
Bei der Entwicklung der Ariane 6 kam es immer wieder zu Verzögerungen. Eigentlich hätte die Rakete bereits 2020 ins All starten sollen. Ihren ersten kommerziellen Flug absolvierte die Ariane 6 im März 2025. Ihren allerersten Start überhaupt hatte sie im Jahr 2024.
Die Verspätungen sorgten dafür, dass viele europäische Satelliten nicht mit dem europäischen Modell ins All geflogen wurden, sondern mit SpaceX, dem Weltraumunternehmen von US-Milliardär Elon Musk.